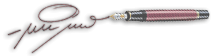Lesen ist mein Höchstes. Lesen und Schreiben. Bei beiden kann ich in meine eigene Welt ab tauchen. UND DEN SHIT DES ALLTAGS VERGESSEN. Momentan heisst dieser Shit: VIRUSGEFAHR. Deshalb: nicht in den Supercenter. Nicht in die Eisenbahn. Und schon gar nicht nach Italien.
ALSO: kein Meeresrauschen zum Frühstück. Keine zitternden Mohnblumen auf den Feldern. Keine Miezen, die mir stolz ihre Jungen vorführen. Und kein zeternder Gianni, der sich auf die Schaufel stützt: «Tutto sciupato - alles verdorrt. Alles zur Sau!» WER HÄTTE GEDACHT, DASS MIR SELBST GIANNIS KLAGELIEDER EINMAL FEHLEN WÜRDEN.
Ich hocke im Garten. Schaue den Kühen mit ihren malmenden Dumpfbacken zu. Und habe dank der Langsamkeit dieser Monate gelernt: nie mehr Kalbsbäckchen servieren. Wer sich je in die freundlichen Augen eines Kalbs verguckt hat, kann dessen Bäckchen nicht mehr auf Quittenschnitzen anrichten, ohne an das kokette Flattern der langen Wimpern zu denken. Nein. Corona hat aus mir keinen Vegi-Fuzzi gemacht - WAS DENKT IHR EUCH NUR! Aber bei KALBSBÄCKCHEN werfe ich künftig das Handtuch. Und auch «Langue de bœuf» kommt mir nie mehr auf den Tisch. Wer sich einmal die mit Salz gefüllte Hand von einer solchen rauen Zunge hat lecken lassen, will dieses Glücksgefühl nicht unter einer Weissweinsauce mit Kapern begraben wissen.
LESEN ALSO.
Da ich literarisch auf niederer Flamme erzogen wurde, lese ich mich synchron durchs Kraut-und-Rüben-Beet: vom neusten Hunkeler (den ich umwerfend finde), über die «Bagage» von Monika Helfer bis zum «Vorhang» - dem letzten Tatort von Hercule Poirot, wo er selber zum Killer wird und dann für immer mit EXITUS aus der Kriminal literatur verschwindet.
ICH BIN KEIN FERNSEHER (ausser «Tatort» am Sonntag, also der ist heilig) - also liege ich bereits um halb neun in den Federn. Und tauche in meine Bücher - wie gesagt: alles parallel. Manchmal, wenn ich bereits im Halbschlaf döse, mische ich die Protagonisten durcheinander - Hercule Poirot wird plötzlich zu Hunkeler und Miss Marple zur heissen Maria Moosbrugger, die für den schönen Georg die Beine spreizt. UND DIES IN IHREM EHEBETT!
Wenn mir meine literarisch hochgebildeten Freunde wie Vrone oder Alain mitunter Tipps über Rilkes Briefwechsel in dessen Dreierbeziehung mit Marina und Boris zuflüstern oder wenn sie mir Schopenhauers «Welt als Wille und Vorstellung» als absolutes «MUST» schmackhaft machen wollen, ergreife ich erschreckt zum neusten Band «Globi und die neuen Arten», obwohl ich noch heute Walt Disneys Daniel Düsentrieb dem Schweizer Vogel vorziehe.
NASERÜMPFEN ERLAUBT. ABER SO BIN ICH NUN MAL!
Mein literarischer Geschmack wurde bereits vor der Einschulung durch Tante Julie geprägt. Die Schwester meines Vaters war eine wunderbare Köchin. Sie knetete, schnipselte, rührte, den ganzen Tag - in ihrer Wohnung duftete es stets nach frisch gebackenen Apfelwähen, nach Zöpfen im Ofen und gekochter Vanillemilch. An einem Samstag deponierte meine Mutter den Buben bei ihrer Schwägerin («Ich muss einmal einen Tag ohne dieses kleine Heulmonster durch atmen können») - Tante Julie drückte mir ein Stück von der lauwarmen Wähe in die Hand. Dazu Grimms Märchenbuch: «Wenn du einen Buchstaben nicht weisst, kommst du in die Küche und fragst.» So lernte ich dank der Brüder Grimm und gefühlten 390 Apfelwähen bereits mit vier Jahren lesen. Meine Mutter nickte zufrieden: «Er kommt nach mir - ein gescheites KIND. ABER KÖNNTEST DU NICHT DEN VIELEN ZUCKER WEGLASSEN, JULIE?» Bis heute wissen wir nicht, was Carlotta mit VIEL ZUCKER gemeint hat. Die Märchen? Den Kuchen? Wie auch immer: «Das Kind wurde eine Zuckerzicke. Und es blieb eine Zuckerzicke. Besonders literarisch.
IN DIESEM ZUSAMMENHANG MUSS ERWÄHNT WERDEN, DASS SICH DAS LITERARISCHE UMFELD DER FAMILIE AUF MUTTERS BÖRSEN BRIEFE UND VATERS «ARBEITER-ZEITUNG» BESCHRÄNKTE.
Nur die Kembserweg-Omi brachte etwas Licht ins literarisch Dustre: Sie kaufte sich jeden Montag den neusten Edelweiss-Roman. Der kam bei mir gleich nach den Märchen. Und ich kapierte bald: Das Gute ist blond. Das Böse schwarz. Und die Intrige beginnt bei der Schwiegermutter.
Es kam dann die erwähnte Mickey-Mouse-Periode, bei der ich allerdings weniger für die Protagonisten Donald und Mickey als vielmehr für Klarabella Kuh und Onkel Dagobert schwärmte. Klarabella Kuh: wegen der klobigen 50er-Jahre-Pumps. Und Onkel Dagobert: weil er meinem Onkel Nudelstadt sehr ähnlich kam.
Erst in der «grossen Schule» versuchten sie mich vom falsch gegangenen Literaturweg auf die Strasse des Guten zurückzuführen. Als sich unser Klassenlehrer für einen Heim besuch anmeldete, bestellte Mutter bei der Büchergilde Gutenberg hastig sämtliche Sammelbände von Goethe, Schiller und Kleist - sie standen dann unberührt während 30 Jahren im grossen Bücherschaft und wurden in ihrer Nobelreihe durch Vaters «Die Arbeiterbewegung und wir» (das er auf sein 25-Jahr-Parteijubiläum erhielt) brutal unterbrochen.
In der mündlichen Deutsch-Matur wurde ich über Droste-Hülshoff und Marie von Ebner-Eschenbach ausgefragt. Ich war damals ganz verrückt auf Emanzipationsliteratur. Und machte mich mit meiner sehr persönlichen Deutung «Lotti, die Uhrmacherin, war die Vorreiterin der modernen Frau» bei den (nur männlichen) Experten unbeliebt.
«SOLLTEN SIE NICHT GESCHEITER EDELWEISS- ROMANE LESEN?», spöttelte einer. «Blond ist gut. Schwarz ist schlecht» - gab ich mein Wissen preis. Er: Daumen nach unten. Und ich fiel durch.
Aber Hercule Poirot hat schliesslich auch den süsslichen Pfefferminzlikör dem Whisky vorgezogen. UND ER WURDE EIN GROSSER MANN.