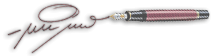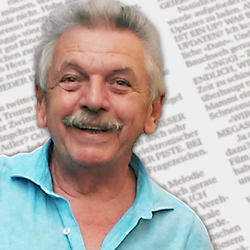Kurz vor seinem Lebensende stiftete Giuseppe Verdi einen Palazzo für alte Sängerinnen und Sänger – ein Besuch.
Mailand - Die Frau im schwarzen Hosenanzug schaut streng über die Brillengläser: «SÌ?»
Die Alte sitzt an der Porte. Und bewacht den Palazzo, wie Zerberus die Hölle.
Ich zeige einen Stapel Mails. Und ein Empfehlungsschreiben.
Freunde vom Freund eines Freundes haben mir das Grünlicht ermöglicht. In Italien ist das Teil des Alltags. Ob das beste Stück beim Metzger oder ein Logenplatz an einer Scala-Premiere: alles nur Beziehungssache.
Die Pförtnerin setzt jetzt umständlich eine Nickelbrille auf. Knurrt unwillig. Und macht sich am Telefon zu schaffen: «Signora Biancamaria…»
Sie schaut mich nochmals durchdringend an: «un signore…»
Das «Signore» tönt so, dass man sich alles darunter vorstellen kann.
Fünf Minuten später erscheint eine elegante Frau. Biancamaria Longoni ist die Sekretärin des Präsidenten der Casa Verdi. Mehr noch: Sie ist das gute Herz, das hier für die grosse Sache des Meisters schlägt.
In Mailand erzählt man sich die Geschichte, der Komponist sei von einem Fan gefragt worden, welches sein bestes Werk sei. Und er habe geantwortet: «La Casa Verdi.»
Biancamaria Longoni hat die Facts etwas präziser: «Verdi wurde kurz vor seinem Tod von einem Freund, dem Bildhauer und Politiker Giulio Monteverde nach seinem ‹Lieblingswerk› gefragt (‹Qual è la tua opera preferita?›). Und Verdi habe keine Sekunde gezögert: ‹E la Casa che ho fatto costruire a Milano per accogliere vecchi artisti di canto non favoriti della fortuna…›»
Gäste, ja nicht Insassen
Verdi hatte in seinem Leben viele verarmte Sänger und Sängerinnen gesehen. Für sie hat er das Haus gebaut – es sollte 100 Gästen (er verbat sich, dass man von Insassen sprach) den Lebensabend erleichtern. Und ihnen ein Zuhause geben – la Casa Verdi.
Zusammen mit seiner zweiten Frau, der Sängerin Giuseppina Strepponi, überwachte er als 86-Jähriger noch die Baustelle. 1897 stirbt die Gattin. Teresa Stolz, die brillante Sopranistin, die seine «Aida» in die Welt trug (und mit der er lange Zeit eine Affäre hatte), begleitet ihn die letzten Jahre. Verdi starb 1901 – drei Jahre nach seiner Giuseppina. Und zwei Jahre nachdem sein «bestes Werk» eröffnet wurde.
Der Meister bestand in seinem Testament darauf «zweiter Klasse» und in aller Herrgottsfrühe («um niemanden zu belästigen») beerdigt zu werden. So wurde er quasi alleine – wie einst Mozart – auf den grossen Mailänder Friedhof überführt.
Es war Teresa Stolz, die schliesslich die Arbeiten zur Krypta in der Casa Verdi vorantrieb. Sie liess die Kapelle auf ihre Kosten mit prächtigen venezianischen Glasmosaiken ausschmücken. Für die prächtigen Arbeiten legte die Primadonna den zu jener Zeit satten Betrag von 28 000 Lire auf den Tisch. Für das Geld hätte sie sich einen ganzen Palazzo kaufen können.
Dank Teresa konnten der Meister und seine Frau nun in die Krypta überführt werden. Tausende von Bewunderern des Komponisten begleiteten den Trauerzug. 800 Choristen sangen zu seinen Ehren. Schliesslich war Verdi ein Volksheld. Er hatte Melodien für die einfachen Leute geschrieben – Nabuccos Gefangenenchor wurde eine Hymne, welche die Menschen auf der Strasse vor sich hin summten.
Signora Longoni öffnet ein imposantes Zimmer. Im Zentrum steht ein riesiger Tisch. Darauf ein längliches Blumengesteck aus Seidenblüten.
An der Wand hängt Tizians «Venus» – eine Kopie. Und im schweren Buffet liegen die Trophäen des Komponisten – darunter ein Taktstock aus Elfenbein und Silber. Kleine Diamanten formen ein V. Das Erinnerungsstück wurde Verdi von den Chorsängern der Kölner Oper anno 1877 am «Musikfest» übergeben.
«Das hier war der Speisesalon der Verdis», lächelt Signora Biancamaria. Und serviert uns schmackhafte Details – etwa, dass der Komponist von seiner Köchin stets ein Risotto in den italienischen Farben Rot, Grün, Weiss komponieren liess.
Es klopft. Und der Presidente betritt den Salotto: Roberto Ruozi, Musikprofessor, eben erst in sein Amt gewählt.
Gottlob – auch er trägt keine Krawatte. Und lacht: «…wir haben die Kleiderordnung etwas gelockert. Heute leben 20 Studentinnen und Studenten im Haus. Da müssen wir mit der Zeit gehen…»
In seinem Testament hat Verdi der Stiftung seine Tantiemen hinterlassen – ein grosses Geschenk. Doch jetzt ist der Geldfluss gestoppt. Die Zeit der Musikprozente ist abgelaufen – wie kommt das Geld heute zusammen?
«Wir haben einen Verein von Freunden, die uns unterstützen. Wir haben ein paar Immobilien, die Geld abwerfen. Und wir haben immer wieder grosse Gönner. Die grosszügigsten waren die Toscaninis. Die Dirigenten-Familie hat uns eine beachtliche Summe hinterlassen.»
Auch grosse Sänger und Primadonnen haben an die Stiftung gedacht. Benjamino Gigli. Die Tebaldi und la Callas. Man sagt, sie habe in ihrem Testament 80 Prozent dem Haus vermachen wollen. «…aber dieses Testament ist nie auffindbar gewesen!»
Wir gehen durch das prächtige Jugendstilgebäude – 40 Zimmer sind für Pflegefälle reserviert: «Physiotherapeuten, Ärzte und Pfleger sorgen für diejenigen Gäste, die Betreuung nötig haben. Dann haben wir 20 weitere Zimmer für alle, die noch gut auf den Beinen sind. Und nochmals 20 für die Studenten. Die Mischung mit den jungen Musikern ist neu. Und hat für beide Seiten viel Positives gebracht…»
Das Wunderbare: Überall erklingt Musik … Piano, Gesang, Hörner.
«Natürlich geben einige der Gäste auch Unterricht. Die Studenten üben hier nonstop. Sie holen sich bei den Musikern gute Ratschläge.»
Immer Klavier spielen
Später treffen wir Sara, eine der jungen Gäste, am Flügel. Sie studiert Komposition: «Es ist zauberhaft, hier leben zu dürfen. Und das Schönste: Man darf einfach immer Klavier spielen – niemand stört dies. Ich wohnte vorher in einer kleinen Wohnung. Da konnte ich nur zu bestimmten Stunden üben …»
Im wuchtigen, hellen Musiksaal, wo Verdi seine grossen Kollegen wie Monteverdi, Rossini, Scarlatti an den Wänden verewigte, werden Lederstühle aufgestellt. Immer am Tag des heiligen Giuseppe, dem 9. April, geben die Musiker der Mailänder Scala in Gedenken an «ihren» Giuseppe hier ein Konzert.
In der Sala Toscanini steht noch Verdis Bechstein-Flügel.
Es ist 13 Uhr. Die Gäste warten darauf, dass man sie zum Mittagessen bittet.
Krawatte zur Pasta
Noch immer herrscht ein bisschen Verdi-Etikette – die Männer haben sich zur Pasta die Krawatten umgebunden, die Frauen sind prächtig aufgerüscht. Und wenn sie auch an Stöcken oder am Rollator in den riesigen Esssaal humpeln, so hat hier alles Stil. Und Würde.
Signora Marisa beispielsweise war Balletttänzerin. Sie winkt bescheiden ab: «… keine der ganz grossen Namen. Nur im Corps der Scala. Aber mir ist wichtig, nicht einzurosten. Ich habe noch ein paar Schüler hier – das hält mich fit…»
Sagts. Und schwebt an ihren Tisch, wo der Kellner schon mit einer grossen Platte dampfender Agnolotti wartet.
Es wohnen nicht nur Sänger in Verdis Casa. Leonello beispielsweise ist Schlagzeuger. Ein nationales Idol in der Jazzszene. Zusammen mit seinem Mitbewohner Giuseppe, einem Ex-Hornisten des Scala-Orchesters hat er eben ein Konzert gegeben.
Wie werden die Leute ausgesucht?
Professore Ruozi lächelt: «Sie machen eine Bewerbung. Und wir schauen, ob etwas frei ist. Und ob sie in den Rahmen passen…»
Er zögert: «Wir haben die unterschiedlichsten Menschen hier. Einige besitzen keinen Centesimo … andere wiederum können mit ihrer Rente etwas zu den Unkosten beisteuern. Aber Geld sollte bei der Auswahl keine Rolle spielen. Wichtig ist, dass sie dazu passen – wir sind ein riesiges Mosaik. Und da sollte jeder Stein richtig gewählt sein, damit das Ganze ein harmonisches Bild abgibt…»
Und die Politik?
Er wirft sich stolz in die Brust: «Hat bei uns gottlob keine Stimme – und nichts zu sagen. Das war eine Auflage des grössten Spenders!»
Geschenk aus Ägypten
In der Sala araba stösst man auf die beiden kostbaren Möbelstücke mit den Elfenbeineinlagen, die Verdi vom ägyptischen Khedive, Ismail Pascha, nach dem Triumph der «Aida»-Premiere geschenkt bekam.
Signora Stefania geniesst es, hier mit ihrer Kollegin Masi diese ganz eigene Stimmung des Prunksaals einzuatmen: «Es ist fast wie ein Bühnenbild», lächelt die ehemalige Contra- Altistin der Scala.
Ob sie noch singe?
Sie lacht: «Nein. Heute male ich. Und gebe den Menschen hier Unterricht. Meine Freundin Masi wiederum setzt die herrlichsten Schmuckstücke aus alten Perlen und Steinen zusammen…»
Masi war ebenfalls Sängerin: «Einmal im Jahr organisieren wir einen Bazar, wo unsere ‹bigiotterie› und Bilder verkauft werden. Der Erlös geht an die Kinder in der Dritten Welt … wir haben es hier wunderbar. Deshalb wollen wir auch etwas weitergeben!»
Als Daniel Schmid, der Bündner Filmemacher vor über 30 Jahren zwei Monate in diesem Haus zu Gast war und sein legendäres Porträt über die Casa Verdi drehte («Il Bacio di Tosca»), brachte dies viel Publicity.
«…anfangs ein bisschen zu viel Umtrieb», meint Präsident Ruozi. «Doch das war nur die erste Zeit. Täglich klopften damals Dutzende von Touristen an, welche das Haus der Sänger sehen wollten.»
Und? Habt ihr die Tore für das Publikum geöffnet?
«Das ist leider nicht möglich. Wir wollen die Privatsphäre der Gäste bewahren. Aber natürlich öffnen wir das Haus immer wieder mal auf Absprache für Besucher…»
Inspiration für Dustin Hoffman
Einer dieser Gäste war vor fünf Jahren Dustin Hoffman. Er hatte sich von Schmid inspirieren und seinen Film «Quartett» in einer Primadonnen-Residenz wie der Villa Verdi spielen lassen.
Der Präsident zeigt uns einen Brief von Ende Februar. Die Casa Verdi hat die Möglichkeit, 82 Epistel des Meisters zu erstehen: «Wenn man bedenkt, dass die meisten Briefe des Meisters verbrannt worden sind, ist das natürlich ein Schatz. Es handelt sich um Schriften, die der Maestro seinem Freund Opprandino Arrivabene geschrieben hat. Sie kosten 120 000 Euro. Das ist viel Geld. Wir versuchen nun mit einem Crowdfunding (www.fundingcarteggioverdi.it) die Summe zusammenzubekommen. Wo gäbe es einen geeigneteren Ort für diese Briefe als in diesem Haus, das Verdi als sein «Vermächtnis an die Musikwelt» ansah…»?
Es ist nun still. Die Gäste (zwischen 65 und 104 Jahren alt) geniessen den Espresso. Sie ziehen sich zur Siesta zurück. Nur ein Klavier spielt Takte aus dem Schlussakt von «Traviata».
La Portiere schaut auf, wie ich die Villa verlasse: «Wir verkaufen auch Verdi-Krawatten», sagt sie.
Ich nehme zwei. Und «ebe…» knurrt sie diesmal zufriedener.
Draussen, auf der grossen Piazza Buonarroti steht die mächtige Statue des Komponisten. Für einmal gibt er sich ganz leger – ohne seinen legendären Zylinder.
Fast hätten wir ihm «Grazie, Maestro» zugerufen.
Aber das wäre falsch. Und ihm peinlich gewesen. Verdi wollte nie einen Dank für etwas, das er «als etwas ganz Selbstverständliches am Ende eines erfüllten Lebens» anschaute…